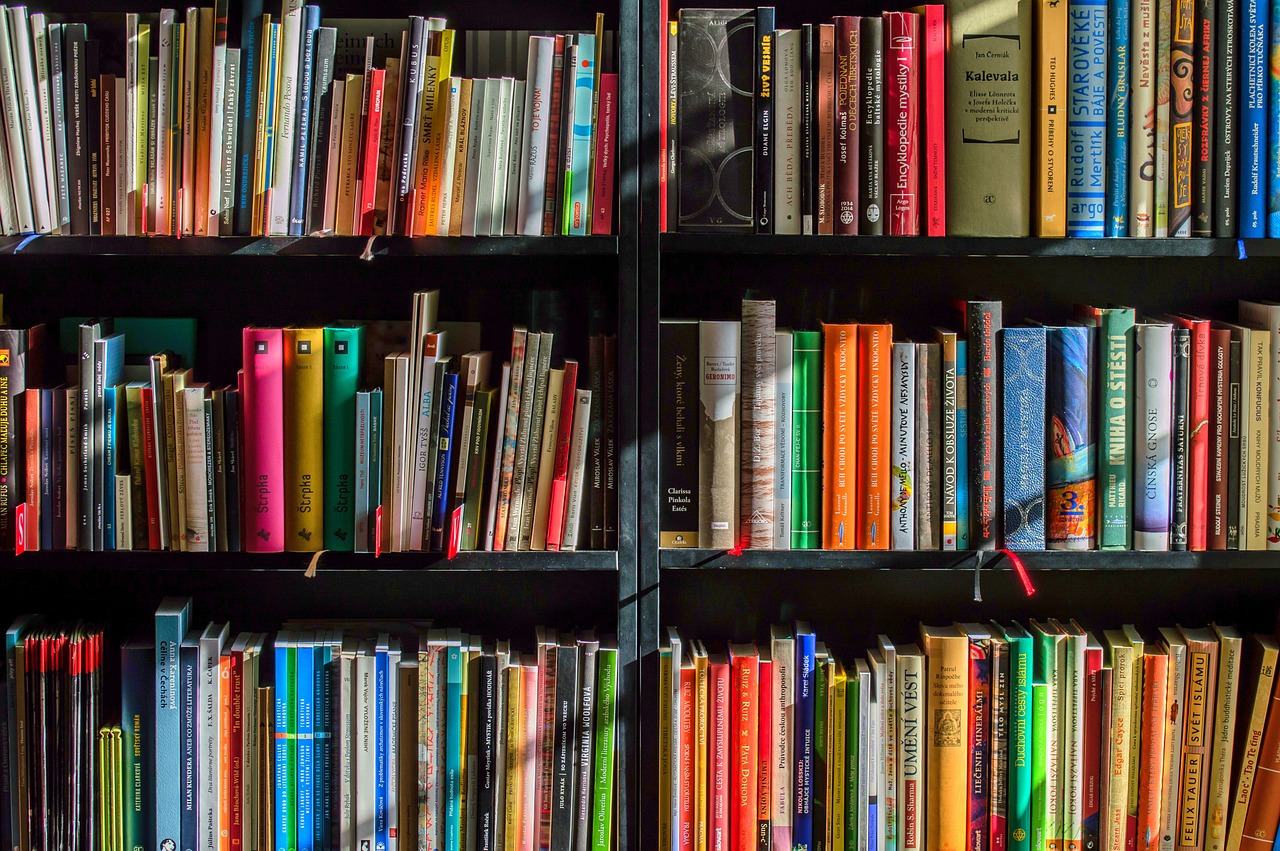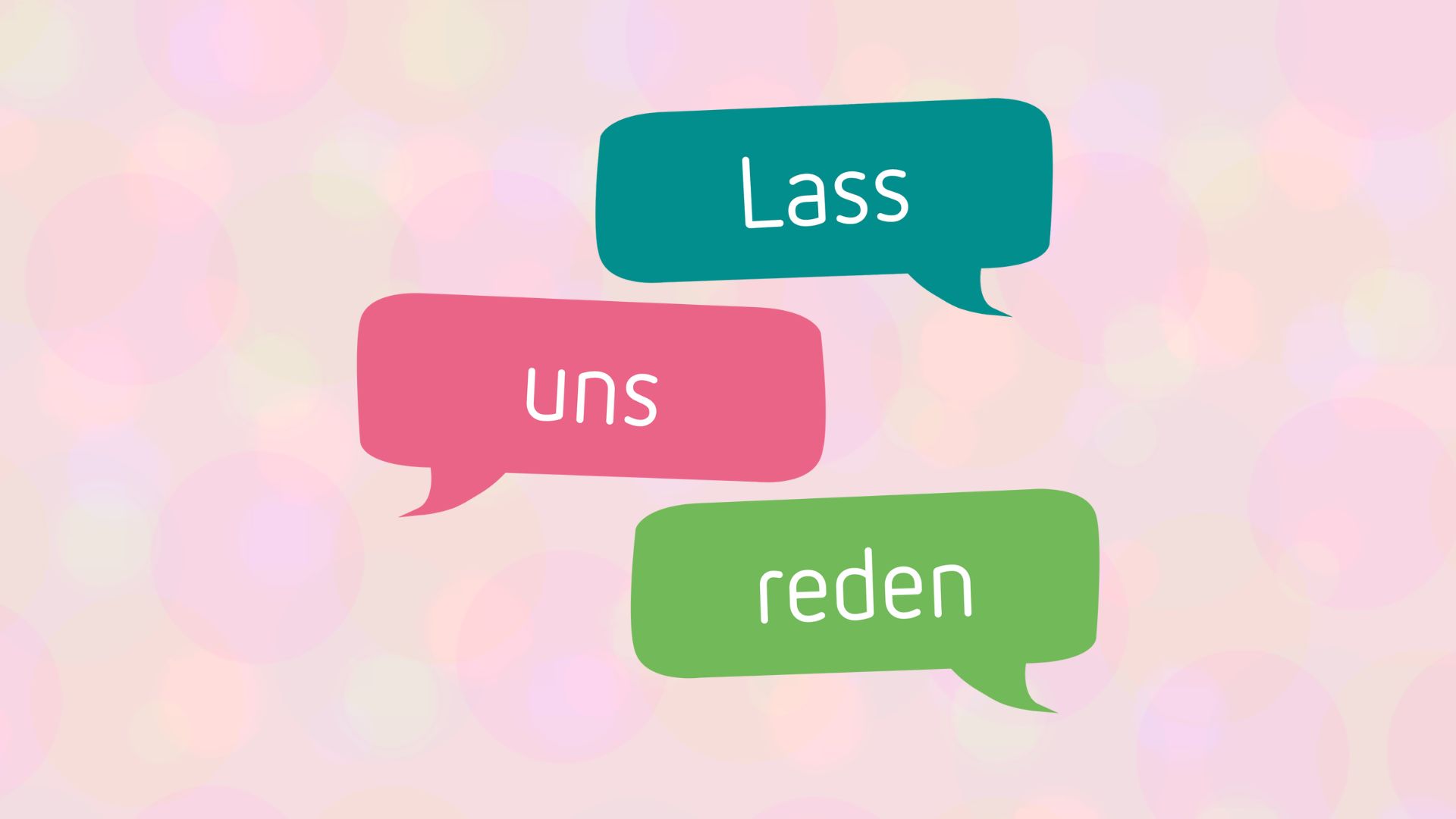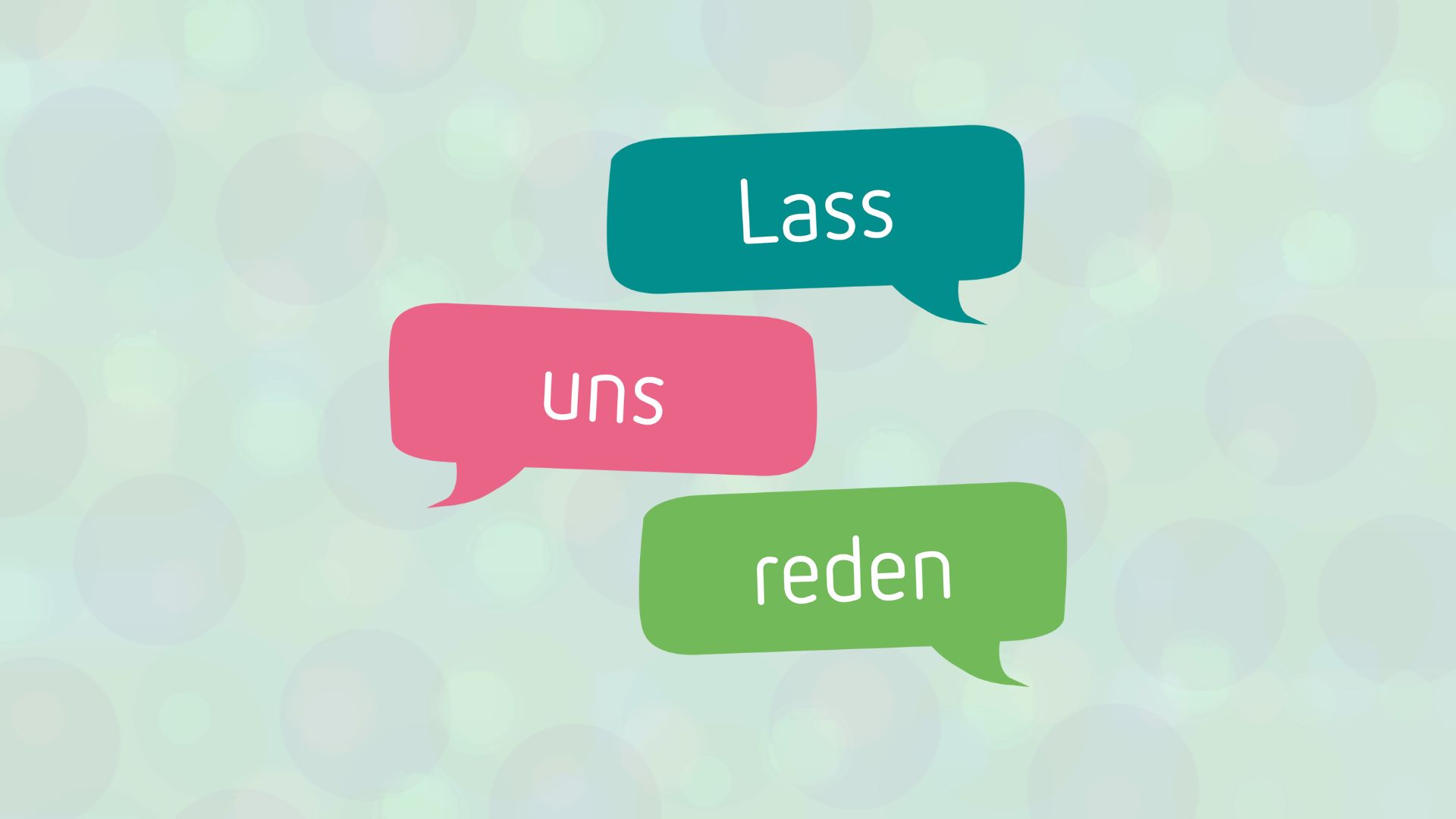Von Gina Köhler
Ungleiche Bildungschancen beeinflussen auch über die Grenzen der Dortmunder Nordstadt hinaus den Lebensweg vieler Menschen. Einer von ihnen ist Sven-Christoph Jung.
„Ach Quatsch, ich habe Zeit! Heute habe ich frei“, sagt Sven-Christoph Jung zu Beginn des Gesprächs auf die Frage, ob das Interview schnell geführt werden muss. Frei bedeutet in dem Fall, dass er heute nicht zur Arbeit muss. So richtig frei hat der 31-Jährige aber nicht. Er schreibt aktuell an einer Hausarbeit im Fach Geschichte, Thema Kaiserreich. Es ist die fünfte von insgesamt sechs Hausarbeiten, die er dieses Semester schreiben muss. Jung studiert in Münster Lehramt auf Sekundarstufe 1, seine Fächer sind Englisch, Geografie und Geschichte. Er bekommt BAföG, ist daher an die Regelstudienzeit gebunden. Da das BAföG allein aber nicht ausreicht, muss er nebenbei noch arbeiten. Im Moment liefert er Lebensmittel aus. Die Doppelbelastung schlaucht: „Für einen allein ist das zu viel, ich könnte noch eine zweite Person einstellen, locker.“
Seine Familie kann ihn nicht unterstützen. Er kommt aus einem Arbeiter*innenhaushalt. Sein Vater war LKW-Fahrer, seine Mutter Krankenschwester. Seine Eltern haben sich früh scheiden lassen, er und sein Bruder sind bei seiner Mutter aufgewachsen. Sie habe damals Doppelschichten schieben müssen, um ihre Familie zu ernähren. „Und ich schiebe jetzt ja auch irgendwie Doppelschichten“, sagt Jung.
Sven-Christoph Jung ist an deutschen Hochschulen ein seltenes Phänomen. Der 31-Jährige aus Herne ist das, was man einen sozialen Aufsteiger nennen kann. Er gehört zu den 30 Prozent der Studierenden, deren Eltern keine Hochschulreife haben. Er gehört zu den gut 17 Prozent der Studierenden, die keinerlei finanzielle Unterstützung von ihren Eltern erhalten. Und er gehört zu den gerade mal 1,4 Prozent der Studierenden an deutschen Universitäten, die ihre Hochschulzugangsberechtigung durch einen beruflichen Abschluss erhalten haben. Das hat die Studierendenbefragung in ihrer 22. Sozialerhebung herausgefunden. Hierfür haben das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, die AG Hochschulforschung der Universität Konstanz und das Deutsche Studentenwerk im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Sommersemester 2021 über 180.000 Studierende von über 250 Hochschulen zu ihrer sozialen und wirtschaftlichen Lage befragt.
Jung hat also etwas geschafft, was vielen anderen mit ähnlichen Grundvoraussetzungen verwehrt bleibt. Und das, obwohl die Bildungschancen in Deutschland enorm vom Bildungsgrad der Eltern abhängen.
„Wir sind nicht nur Weltmeister im Fußball, sondern auch bei der Chancenungleichheit“, meint Ahmet Toprak. Auch er hat den sozialen Aufstieg geschafft. Als Kind kam er mit seinen Eltern, Gastarbeiter*innen der ersten Generation, nach Deutschland. Hier ging er zuerst auf die Hauptschule, hat dann das Abitur nachgeholt, studiert und promoviert und hat inzwischen eine Professur für Erziehungswissenschaften an der Fachhochschule in Dortmund inne.
Gerade bei der Berufswahl zeigen sich seiner Ansicht nach deutliche Unterschiede in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft. Es sei empirisch belegt, dass soziale Aufsteiger*innen, also diejenigen, die ursprünglich aus einer sozioökonomisch schwächeren Schicht kommen, ihre Berufe und Studiengänge häufig pragmatischer wählen als ihre Studienkolleg*innen. „Für viele ist die Studienwahl da eine Rechnung. ‚Wenn ich schon mal aufsteige, dann in einen prestigeträchtigen Job‘. Aber eben auch in einen Job, der mir garantiert, dass ich ein gutes Gehalt bekomme. Kunstgeschichte oder Philosophie oder Sprachwissenschaften sind eher Bereiche, die von solchen Gruppierungen nicht bevorzugt werden.“
Solche Abwägungen haben auch Sven-Christoph Jung beschäftigt. Für ihn war die Berufsfindung ein aktiver Prozess. Nach der mittleren Reife hat er eine Ausbildung zum Fleischer gemacht. Wieso, kann er heute gar nicht mehr so genau sagen. „Mein Großvater war Schornsteinfegermeister und hat mich früher öfter mit auf die Arbeit genommen. Vielleicht wollte ich deshalb auch ins Handwerk“. Er hat jedoch schnell gemerkt, dass das Fleischereihandwerk für ihn keine Zukunftsaussichten hat. „Hier laufe ich direkt in die Altersarmut“, meint er. Ein Ausbilder erzählt ihm davon, dass er mit einem Meister auch ohne Abitur studieren kann. Das hat für Jung alles verändert.
„Das mit dem Abitur, das hätte für mich sowieso nicht funktioniert.“ Also hat Jung seinen Fleischermeister gemacht und sich an der Universität Münster eingeschrieben. Dass er sich letztlich für Lehramt entschieden hat, hatte verschiedene Gründe. „Ich habe mir alles ganz genau angeschaut, habe alles recherchiert und Berufsorientierungstests gemacht“, meint Jung. Schnell stand für ihn fest, dass es „irgendwas Soziales“ werden sollte.
Die Jobsicherheit, das Gehalt und die Aussicht auf Verbeamtung haben dann den Ausschlag für den Lehrerberuf gegeben. Außerdem war die Machbarkeit für Jung ein entscheidender Faktor. „Ich wusste, dass ich auf BAföG angewiesen sein werde, und dass ich mir keine Umorientierung erlauben kann. Ich musste vorher also ganz sicher sein, dass ich meinen Plan so in die Tat umsetzen kann.“
Viele Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch schwächeren Milieus schaffen den Weg an die Hochschule gar nicht erst. Der Hochschulbildungsreport aus dem Jahr 2021 zeigt: Von 100 Kindern aus Akademiker*innenhaushalten beginnen 79 Kinder nach der Schule ein Studium. Von 100 Kindern aus Arbeiter*innenhaushalten sind es gerade mal 27 Kinder.
Laut dem Chancenmonitor des ifo Instituts spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Ein Kind, das bei einem alleinerziehenden Elternteil ohne Abitur und mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 2.600 Euro aufwächst, besucht später mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 21 Prozent ein Gymnasium. Ein Kind, das in einem Haushalt mit beiden Eltern aufwächst, die beide Abitur gemacht haben und gemeinsam mehr als 5.500 Euro netto monatlich verdienen, hat dagegen eine Wahrscheinlichkeit von gut 80 Prozent, dass es später ein Gymnasium besucht. Ein Migrationshintergrund spielt laut dem Chancenmonitor eine untergeordnete Rolle. Der Einfluss des sozialen Milieus sei höher als der des Migrationshintergrunds.
Die Erfahrung hat auch Ahmet Toprak gemacht. Sein Sohn sei in der Schule nur „der Sohn des Professors“. Sein Migrationshintergrund spiele hingegen kaum noch eine Rolle. Ein Migrationshintergrund und eine schlechte sozioökonomische Stellung treten aber häufig gemeinsam auf. „Man muss überlegen, welche Menschen ihr Heimatland verlassen, um ein neues Leben in Deutschland zu beginnen. In den letzten Jahren waren es immer öfter auch Fachkräfte, ja, aber die 70 Jahre davor sind in erster Linie Menschen aus benachteiligten Milieus mit wenig Bildungskapital nach Deutschland gekommen“, erklärt Toprak.
Das Einkommen der Eltern, deren Bildungsgrad, finanzielle Mittel, ein möglicher Migrationshintergrund – verschiedene Größen nehmen einen Einfluss auf die Bildungschancen von Kindern. „Wir haben es immer noch nicht geschafft, den Bildungsaufstieg von der Herkunft der Eltern abzukoppeln“, so Toprak.
Toprak sieht den Hauptgrund für diese Ungleichheit im Schulsystem. Seiner Meinung nach sollten Grundschüler*innen nicht schon nach vier Jahren auf verschiedene Schulformen aufgeteilt werden. „Es gibt Studien, die belegen, dass das Kind eines Arztes dem Kind eines Facharbeiters bei der Einschulung schon etwa ein bis eineinhalb Jahre voraus ist, was seinen Kenntnisstand angeht. Diese Lücke kann das Facharbeiterkind in vier Jahren natürlich nicht schließen.“
Toprak befürwortet deshalb die Abschaffung der Frühselektion. Er plädiert für eine gemeinsame Beschulung aller Kinder und Jugendlichen bis Klasse 10 mit individuellen Förderkonzepten. Schwächere Schüler*innen sollten unterstützt, stärkere Schüler*innen gefördert werden. Außerdem bräuchte es flächendeckend Ganztagsschulen. So würden die Eltern entlastet und es sei eher möglich, familiäre Defizite aufzufangen.
Auch Sven-Christoph Jung sieht Reformationsbedarf: „Aktuelle Reformen sind eher Kosmetika, die richtigen Probleme werden nicht angegangen.“ Er musste sich selbst mühselig aus einem System herausarbeiten und sich seinen eigenen Weg schaffen. Jung möchte später dazu beitragen, dass seine Schüler*innen es leichter haben als er. Daher plant er aktuell auch seine Bachelorarbeit zum Thema Berufsorientierung. „Ich will auf jeden Fall versuchen, meinen Schüler*innen später bei der Orientierung zu helfen. Ob es funktioniert, keine Ahnung, ich bin ja dann auch nur eine Lehrkraft im System. Aber ich kann und werde es zumindest versuchen.“
Ahmet Toprak sieht die Verantwortung für den Systemwechsel nicht beim Individuum, sondern bei der Politik. Seiner Meinung nach müsste viel mehr in Bildung investiert werden. Laut Daten des Statistischen Bundesamts verließen im Jahr 2020/21 rund sechs Prozent aller Schüler*innen in Deutschland die Schule ohne Abschluss. Bei den Schüler*innen ohne deutsche Staatsbürgerschaft lag der Anteil sogar bei fast 15 Prozent. Für Toprak unverständlich. „Diese Kinder sind ja nicht dumm. Wir jammern, dass wir keine Fachkräfte haben, verlieren dann aber jedes Jahr potenzielle Fachkräfte, weil sie die Schule ohne Abschluss verlassen. Das kann sich Deutschland auf Dauer nicht leisten.“
Seiner Meinung nach bräuchte es eine Umverteilung. „Es ist eine Sache von Prioritäten. Was ist mir wichtiger, gebe ich mehr aus für Wirtschaft oder Verteidigung oder für Bildung?“ Ob es je zu einem solchen Systemwechsel kommen wird, ist unklar.
Die Zeit bis dahin nutzt Sven-Christoph Jung sinnvoll. Neben seinem vollen Zeitplan versucht er, auch noch den Sport und seine ehrenamtlichen Tätigkeiten unter einen Hut zu bekommen. In seiner Freizeit engagiert er sich unter anderem bei „ArbeiterKind.de“. Die gemeinnützige Organisation hilft Erstakademiker*innen bei allem, was mit Hochschule und Berufsorientierung zu tun hat. Wenn er es zeitlich schafft, hält Jung beispielsweise Vorträge an Schulen. Er profitiert aber auch selbst vom Netzwerk, das die Organisation ihm bietet. „Dieses Netzwerk, was viele aus Akademikerfamilien von Haus aus haben, baue ich mir seit Jahren mühsam selber auf“, erzählt Jung.
Fotos:
1. Foto von Sven-Christoph Jung: Privat.
2. Foto von Ahmet Toprak: Marcus Heine.